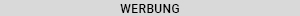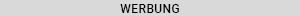Kolumne von Johannes Jenny

Die Mbyá Guaraní lebten bis zur Entdeckung Amerikas durch die Europäer Jahrtausende im Einklang mit dem Atlantikurwald. Sie fühlen sich als Teil des Waldes. «Mein eigentlicher Name ist ‹Verá Mirí’» sagt der Häuptling. Den amtlichen Namen auf seiner Identitätskarte braucht er hauptsächlich für den Austausch mit den Behörden. «Verá Mirí» übersetzt er mit «Luz en el cielo cuando hay tormenta» – «Licht am Himmel, wenn es stürmt». Dass sein Licht immer wieder leuchtet, zeugt von grosser Kraft und Durchhaltewillen: 1962 finanzierten Schweizer Gläubige den Abbruch der Hütten und des Gotteshauses seiner Gemeinschaft, um eine Schweizerschule zu bauen. Achtlos wurde der Friedhof der Mbyá gepflügt und der Wald grösstenteils gerodet. Den Ureinwohnern wurde ein Fleck Erde in mehreren Kilometern Entfernung zugewiesen. In der Gewissheit Gutes zu tun, wurde auch dort eine Schule gebaut, um die Mbyá, nach dem damaligen Verständnis, zu entwickeln und zu «nützlichen Gliedern» der weissen Gesellschaft zu machen. Die Lehrpersonen waren weiss und konnten kein Mbyá Guarani. Die Sprache der Indigenen war nicht erwünscht. Später wurden Mbyá als Hilfslehrer eingesetzt und die Schule als «zweisprachig» angeschrieben – jedoch nur auf Spanisch.
Geschichten von Vertreibung und Unterdrückung, wie die von Verá Mirí und seiner Gemeinschaft Takuapí fanden und finden noch immer im Dreiländereck Paraguay, Brasilien und Argentinien statt. In Argentinien geht es den Mbyá heute aber sogar vergleichsweise gut. In Paraguay zerstören bis heute Mennoniten – im Namen Gottes – Natur und Kultur der Mbyá. Seit ein Mann namens Jair Messias Bolsonaro in Brasilien mit messianischem Eifer Wälder samt indigener Bevölkerung zerstört, flüchten vermehrt Mbyá nach Argentinien. Wie der schweizerische ging der argentinische Bundesstaat letztlich aus den napoleonischen Wirren hervor. Im 19. Jahrhundert suchten mausarme Schweizer Wirtschaftsflüchtlinge ihr Glück in Argentinien, seit 30 Jahren kommen viele Urenkel zurück. Die Minderheit der indigenen Völker, welche kaum 3 % der Argentinier ausmachen, konnten sich vor 20 Jahren das verfassungsmässige Recht erstreiten, gemeinschaftliches Grundeigentum zu besitzen und nach ihrer Kosmovision selbstbestimmt zu leben. Das spricht für die Kraft ihrer Kultur, den Willen der indigenen Bevölkerung – und ist ein Zeichen dafür, dass sich der Rechtsstaat in Argentinien trotz Krisen festigt. Das ist ein Silberstreifen am Horizont – ein Licht am stürmischen Himmel: Pro 15.– Franken Spenden kann der kleine Verein Sagittaria 100 Quadratmeter Wald den Mbyá zurückgeben. Wald, der wächst, CO2 aufnimmt, das Klima der Erde kühlt und den Menschen dient, die sich als Teil der Natur empfinden.